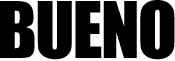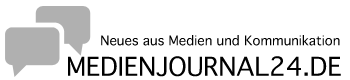Renates Geheimnis, Vogelers Suche nach dem „Wahren“, Karsten und die sozialistische Moral – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis
26 Nov
November 1989. Vor nunmehr 32 Jahren ist die Mauer gefallen. Und die Zeiten haben sich vor allem für die Bürgerinnen und Bürger der früheren DDR heftig geändert. Wie sich diese Wende auf die Menschen hierzulande ausgewirkt hat, damit befassen sich gleich zwei der insgesamt fünf aktuellen Sonderangebote dieses Newsletters, die wie immer eine Woche lang zum Sonderpreis im E-Book-Shop www.edition-digital.de (Freitag, 26.11. 21 – Freitag, 03.12. 21) zu haben sind – wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.
So beginnt in „Kalter Mai“ von Jutta Schlott im warmen und sonnigen Sommer des Jahres neunzehnhundertneunundachtzig die Geschichte des Mädchens Katharina Eschenbach, die bald 16 werden wird. Es ist eine Geschichte von Veränderungen, und es ist die Geschichte einer nicht immer ganz einfachen ersten Liebe.
In der Wendezeit spielt auch der Roman „Achterbahn. Höhenflug und freier Fall“ von Rudi Czerwenka. Es gibt Gewinner und Verlierer. Und das Leben ist wie eine Achterbahn.
Dem Leben des Malers Heinrich Vogeler und seiner Suche nach dem „Wahren“ ist Jutta Schlott mit ihrer großartigen Biografie „Farbenspiele“ auf der Spur. Und obwohl das Buch 1989 im Kinderbuchverlag Berlin erschienen war, ist es doch kein Kinderbuch.
Fragen an die Vergangenheit und Gegenwart eines neuen Bundeslandes mit langer Tradition stellt Hans Bentzien in seiner Geschichte Brandenburg-Preußens für jedermann „Unterm roten und schwarzen Adler“.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Im Mittelpunkt des heute vorgestellten utopischen Romans, der schon vor nunmehr fast vier Jahrzehnten erstmals veröffentlicht wurde, stehen existenzielle Fragen, wie sie sich auch uns Heutigen stellen. Hat die Menschheit Kraft und Verstand genug, die großen Herausforderungen zu bewältigen?
1976 erschien im Verlag Neues Leben Berlin als Band 128 dessen Reihe „Spannend erzählt“ der Wissenschaftlich-phantastische Roman „Expedition Mikro“ von Alexander Kröger. Dem E-Book liegt die Originalausgabe von 1976 zugrunde. Es wurde lediglich auf neue Rechtschreibung umgestellt: Wie ein gewaltiger Trichter öffnet sich vor ihnen der Schnabel des Riesenvogels, und ihr Hubschrauber verschwindet in dem unermesslichen Schlund. Entsetzt blickt Gela Nylf auf die Gefährten, die sich im bleichen Licht der Kabinenbeleuchtung zu orientieren versuchen. Wird auch diese Expedition misslingen, nachdem schon ihre Vorgänger in jener seltsamen Welt verschollen sind, die sie so schwer begreifen können? Gela denkt an Harold, der die vorige Expedition leitete und nie zurückkehrte. Hat er die sagenhaften Wesen getroffen, die mitunter wie wolkige Schemen am Horizont aufgetaucht sind? Ist der Kontakt mit ihnen tödlich, oder wird er die ersehnte Hilfe bringen?
Die Hubschrauberbesatzung tut alles, um aus dem fliegenden Gefängnis freizukommen. Die Expedition darf nicht scheitern, denn zu viel hängt von ihrem Erfolg ab: die Existenz auf der kleinen Insel inmitten des Ozeans, die Heilung der Krankheit, die dort grassiert, die Rettung vor den bedrohlichen Naturgewalten … Und so stellen sich Gela Nylf, Chris Noloc und die anderen immer neuen Gefahren und Abenteuern. Hier der Beginn dieses noch immer mit Spannung zu lesenden Buches:
„Erstes Kapitel
„Und ich sage dir, dass wir die Gefahr für uns alle nur vergrößern, wenn wir wieder nach Hause aufbrechen!“, sagte Gela Nylf ärgerlich. Sie strich mit vier Fingern der linken Hand über die Tischkante, den Daumen als Führung benutzend. Ihr Gesicht war gerötet, die Augen kniff sie zusammen, die hohe Stirn zog Falten. Sie blickte an ihrem Widersacher, dem Biologen Charles Ennil, ein wenig vorbei. Er wiederum bemühte sich, sie nicht voll anzusehen. Gela Nylf schielte ein wenig, fast unmerklich. Ihr Blick hatte dadurch nicht jene musternde Schärfe, und ihre Partner konnten leicht den Eindruck gewinnen, sie sei nicht ganz bei der Sache. So empfand im Augenblick auch Ennil.
„Es gab auf der Fahrt hierher im Grunde genommen keine echte Gefahr“, entgegnete er verächtlich. „Was soll unserem Schiff passieren! Dreimal haben uns diese Salmons und die anderen Fische geschluckt, und was war? Außer dass die Scheiben ein wenig blind geworden sind und wir im Übrigen gründlich die Orientierung verloren haben, geschah doch nichts! Aber wenn wir hierbleiben …“ Er vollendete den Satz nicht. Es war jedem der Anwesenden klar, was er damit sagen wollte.
Gela senkte den Blick. Sie spürte wieder den Schauer über ihren Körper laufen wie damals, als dieses Meerungeheuer das Schiff schluckte. Dann tagelang die Finsternis um sie herum, das Schiff eingeschlossen von zersetzten Tierleibern und von Pflanzenresten. Würden diese Biester nicht alles, was sie greifen, hinunterschlucken, sondern kauen, wir wären jetzt … Und wer sagt, dass es nicht welche gibt, die kauen? Der Ozean wimmelt von solchen und noch größeren Ungeheuern geradezu. Und da sagt dieser Charles: Da war doch nichts! Natürlich hat er insofern recht: Außerhalb des Schiffes werden die Gefahren größer sein.
„Nun, machen wir Schluss mit der Diskussion!“ Robert Tocs, der Leiter der Expedition, hatte es energisch gesagt. Er sah unter seiner auf die Stirn geschobenen Brille hervor Charles Ennil zwingend an. „Außer dir, Charles, sind alle dafür, dass wir auch unter diesen Umständen die Aufgabe erfüllen. Es ist mir klar, dass es schwierig und vielleicht auch opferreich sein wird. Aber schließlich war uns das von Anfang an klar.“
„Aber …“, warf Ennil ein.
Robert Tocs erhob nur ein wenig die Stimme und fuhr ungeachtet des begonnenen Einspruchs fort: „Charles, ich bin mir sicher, dass es nicht etwa Angst um dein Leben ist, was dich so sprechen lässt. Dafür kenne ich dich zu gut. Du denkst vor allem an uns neunundzwanzig übrige. Das ehrt dich natürlich. Aber von Gela, unserem Küken, hast du eben gehört, was sie von deiner Fürsorge hält. Es entspricht unser aller Meinung.
Also: Morgen startet eine Exkursion ins Landesinnere zur Erkundung eines Stützpunktes.“
Tocs Blick ging über die Köpfe. Jens Relpek, der Physiker, blickte aus wasserklaren Augen zurück. – Nein, er ist zu weich, zu gründlich auch. Er würde lange wägen vor jeder Entscheidung – auch dann, wenn es auf die Sekunde ankommt.
Gela – zu unerfahren, sie also noch nicht. Sie brennt sicher darauf, aber es wäre falsch. Ennil ist für die Leitung der Exkursion vorgesehen. Aber jetzt, nach seiner Äußerung? Bei ihm besteht auch die Gefahr, dass er zu tief ins Fachliche gleitet, im Registrieren und Eingruppieren das Leiten vergisst.
Chris Noloc, sieh nicht so herausfordernd her. Ich weiß, dass du dazu einmal fähig sein wirst, noch bist du mir aber zu draufgängerisch, bringst womöglich deine Begleiter unnötig in Gefahr. Mieh, den Arzt, kann ich nicht von hier fortlassen. Er muss für die Mehrheit da sein. Seine Frau wird die Exkursion begleiten. Leiten kann sie sie nicht. Wer also? – Ich! Das wäre gegen die Vernunft und gegen die Instruktion …
Wieder machte Tocs Blick die Runde. Dann strich er sich über die Augen und sagte: „Charles Ennil wird die Exkursion leiten. Sie fliegt mit dem kleinen Helikopter. Die Mannschaft stellst du dir selbst zusammen, Charles.
Ich danke, gute Nacht. – Du bleib noch einen Augenblick, Chris!“
Tocs war mit den anderen aufgestanden. Als sie gegangen waren, trat er an die große Rundsichtscheibe der Brücke und starrte nach draußen. Sie hatten die Scheinwerfer gelöscht. Das Stück Himmel über ihnen lag in einem fahlen Schein. Nur die großen Sterne durchdrangen ihn. Unmittelbar vor dem Schiff türmte sich die trostlose Geröllwüste.
Kommandant Tocs lächelte. Er dachte an das schwierige Landemanöver. Erst gebärdeten sich alle ungeduldig, als endlich Land in Sicht war, nur ich zögerte. Auch du, Chris, hast das zunächst nicht verstanden.
Tocs hatte sich umgedreht und sah Chris, der gleich ihm am Fenster stand und in die Dunkelheit starrte, von der Seite her an. – Es war eben doch gut, erst eine besonders hohe Welle abzuwarten und dann mit voller Kraft aufzulaufen. So war es möglich, mein lieber Chris, gleich ein schönes Stück ins Land hineinzukommen, ohne dass uns die nächste Welle wieder zurückzog.
Chris Noloc fühlte sich stolz: Endlich eine Aufgabe, dachte er. Diese Nerven tötende Seefahrerei, trotz dieser Ungeheuer. Im Grunde genommen war sie äußerst langweilig gewesen.
Warum wohl Robert gezögert hat, als es um die Leitung der Exkursion ging? Schließlich stand Ennil von vornherein fest – oder Gela. Nun ja, seine Unkerei macht ihn ein wenig unglaubwürdig. Chris bemühte sich, im Schein der schwachen Brückenbeleutung draußen etwas zu erkennen. Geröll und aufgetürmte Haufen aus abgeschliffenen Steinen, dazwischen breite Kriechspuren von Tieren. Ein normaler Küstenstreifen, dachte Chris, fast gleich dem, der sich um unsere Insel zieht.
„Chris, ich habe Ennil empfohlen, dich mitzunehmen“, sagte Tocs plötzlich und blickte nach wie vor in die Finsternis hinaus.
„Ja“, antwortete Chris Noloc ruhig. Er sah auf die dunkle Silhouette des Kommandanten. „Ennil hat mit mir gesprochen. Carol soll als Ärztin dabei sein und Karl Nilpach als Pilot und Techniker.“
„Was sagst du zu Charles als Leiter?“, fragte Tocs.
Chris überraschte die Frage. Eine Kritik oder auch nur Stellungnahme zu einer Entscheidung des Kommandanten stand ihm laut Reglement nicht zu. Er zuckte die Schultern, dann sagte er zögernd: „dass er auf Gefahren aufmerksam macht, halte ich nicht für falsch. Vielleicht hätte er sich dazu eine bessere Gelegenheit suchen sollen. Es ist nicht beispielgebend, wenn ausgerechnet der Leiter nochmals allgemein bekannte Schwierigkeiten aufzählt. Ansonsten: Er hat einen Blick für Neues, und er ist fachlich sehr beschlagen.“
„Er scheint mir in der letzten Zeit ein wenig zerstreut …“, entgegnete Tocs nachdenklich, doch dann schob er seine Bedenken beiseite.
„Gut“, sagte er, und die Angelegenheit war für ihn wohl endgültig erledigt. „Ich bin dafür“, setzte er hinzu, „dass ihr Gela mitnehmt. Sie soll Erfahrungen sammeln.“
Chris fühlte, dass ihm das Blut zu Kopf stieg. Nach einer Weile sagte er: „Bitte sag du ihr das. Du weißt, es gibt ohnehin schon Geflüster.“
„Ich finde nichts dabei, wenn man jemanden na – sympathisch findet, so wie du Gela“, sagte Tocs, und Chris erriet, dass er lächelte.
„Bloß wenn es nicht auf Gegenseitigkeit beruht, wirkt’s leicht komisch“, entgegnete Chris mit brüchiger Forsche in der Stimme, und er starrte erneut aus dem Fenster.
„Willst sie also nicht mithaben!“, stellte Tocs fest, und er sah schmunzelnd zu Chris hinüber.
„Doch, doch“, beeilte sich Chris zu antworten. Dann setzte er noch eifrig erläuternd hinzu: „Es geht wohl in erster Linie um die Sache. Und Gela muss anfangen!“
Jetzt lachte Robert Tocs. „Sprichst, als hättest du bereits fünfundzwanzig anstatt zwei ähnlicher Einsätze hinter dir. Und die zwei waren im Küstenstreifen unserer Insel und werden mit dem hier nicht vergleichbar sein. Übrigens, in dem Zusammenhang …“, Tocs sah Chris jetzt voll an, „… bist vorsichtig, ja?“
„Aber ja! Mir ist bislang noch nichts zugestoßen“, sagte Chris, und es klang ein wenig unwillig.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
1993 veröffentlichte Jutta Schlott im Alibaba Verlag Frankfurt/Main „Kalter Mai“: Im nördlichsten der gar nicht so neuen Bundesländer verlieren Katharinas Eltern in der Zeit der neuen Freiheit ihre Arbeit und müssen mit der Tochter in ein Kaff ziehen. Zwei Jahre lang bleibt Katharina isoliert, trauert ihrer Freundin nach, die jetzt irgendwo im Westen wohnt, – und kann nichts mit ihren Klassenkameraden im (ebenfalls) neuen Gymnasium anfangen. Erst als sie Roland kennenlernt, findet sie Zugang zu anderen Jugendlichen, lernt deren Probleme und Möglichkeiten kennen. Mit Roland erlebt sie ihre erste Liebe, die sie hoffnungsfroh, aber auch manchmal verzweifelt macht. Zunächst aber vertraut ihr ihre Freundin Renate, genannt Natter, ein brisantes Geheimnis an:
„1. Kapitel
Im warmen und sonnigen Sommer des Jahres neunzehnhundertneunundachtzig war das Mädchen Katharina Eschenbach in Gedanken vor allem mit einem Tag im Oktober beschäftigt, dem siebenten im Monat, ihrem sechzehnten Geburtstag.
Von diesem Zeitpunkt an waren ihr Freiheiten versprochen, die sie zwar lange für selbstverständlich hielt, die sie sich jedoch von Fall zu Fall hartnäckig erkämpfen musste.
Der entscheidende Grad der Freiheit bestand darin, die Stunde ihrer abendlichen Heimkehr in die Wohnung selber zu bestimmen.
Das schien ein Problem zu sein, mit dem alle Mädchen ihres Alters kämpften, wogegen für die meisten Jungen die Frage längst zu ihren Gunsten entschieden war.
Während der Ferien hatte das Mädchen sich ausgemalt, wie sie ihren Sechzehnten gemeinsam mit ihrer Freundin Renate, Natter genannt, verbringen wollte. Sie hatte sich ein Programm zurechtgelegt, nach dem sie auf keinen Fall vor Mitternacht zurückkehrten. Ob Natters Eltern zustimmten, blieb abzuwarten. Katharina war entschlossen, sie mit der frisch erkämpften Großzügigkeit der eigenen Eltern zu überzeugen.
Am ersten Tag des neuen Schuljahres, bevor Katharina dazu kam, etwas von ihrem Vorhaben zu erzählen, zog Natter die Freundin in die hintere Fensterecke und ließ sie schwören, niemandem, wirklich niemandem ein Wort von dem zu sagen, was sie ihr mitzuteilen habe.
Katharina schwor es – halb belustigt, halb beleidigt -, weil sie Natters Ängstlichkeit als kränkend empfand. Die Freundin wusste, dass sie ein Versprechen immer gehalten hatte.
Nach den aufwendigen Vorbereitungen sagte Natter nur einen Satz: „Meine Alten haben einen Antrag laufen.“
Sie hatte sich wohl vorgenommen, ein bedeutungsvolles oder zumindest ernstes Gesicht zu machen, aber es missriet. Stattdessen verzog sich ihr Mund zu einem merkwürdig schiefen Grinsen, von dem Katharina gegen ihren Willen angesteckt wurde.
In diesem Moment betrat Physiklehrer Heinrich Grube, unter den Schülern Grübchen genannt, den Raum. Die Mädchen gingen schweigend zu ihren Plätzen. Sie saßen nebeneinander, und während der Stunde versuchte Katharina – den Flüsterton wahrend – mehr als den einen Satz von der Freundin zu erfahren. Natter schüttelte auf alle Fragen den Kopf und legte zum Zeichen der Verschwiegenheit den Zeigefinger auf den Mund.
„Willst du auch weg?“, versuchte Katharina herauszubekommen. „Oder gehst du nur mit, weil deine Eltern den Ausreiseantrag gestellt haben?“
Natter hob die Schultern und antwortete stereotyp: „Ich weiß nicht!“
„Warum verschwindet ihr nicht einfach über die Grenze in Ungarn!“, bedrängte Katharina die Freundin. „Oder über die Botschaft in Prag?“
Natter zuckte mit den Achseln, wich dem Blick der Freundin aus und schwieg.
Die Vorstellung, dass ihre Freundin, die sie seit zehn Jahren fast täglich traf, von einer Minute zur anderen verschwinden konnte, schob alle sorgfältig ausgedachten Pläne für den Geburtstag in den Hintergrund. Von dem, was sie sich für ihren Sechzehnten ausgedacht hatte, sagte sie Natter nichts. Es war unwichtig geworden.
Sie begann Natter wie eine Fremde zu betrachten – oder schlimmer noch: wie eine Todeskandidatin.
Wer in den Westen ging, war wie von der Erde geschluckt.
Meist kam nicht mal eine Ansichtskarte, weil die Ausgereisten fürchteten, den Zurückgebliebenen Unannehmlichkeiten zu bereiten.
Wenn Natter sich morgens zum Unterrichtsbeginn nicht wie üblich zehn Minuten eher auf dem Schulhof einfand, fing Katharinas Herz vernehmlich zu schlagen an. Bei jeder Zensur, die die Freundin erhielt, dachte Katharina: Das ist die letzte. Wenn sie nach der Schule am Kiosk auf der anderen Straßenseite im Klüngel noch eine halbe Stunde herumlungerten – es war der Ort, wo man von den Lehrern ungesehen oder zumindest übersehen rauchen konnte -, dachte Katharina, wenn sich Natter auf ihr Fahrrad setzte und mit dem gewohnten „Tschüssi“ davonfuhr: zum letzten Mal.
Als nach ein paar Wochen nichts geschehen war, begann das Mädchen, die Angelegenheit gelassener zu betrachten. Die meisten Ausreiseanträge wurden von den Behörden sowieso erst einmal abgelehnt. Das Ganze zog sich über Monate, manchmal über Jahre hin und konnte länger dauern als das zehnte Schuljahr, das letzte gemeinsame der Freundinnen. Danach würde Katharina in einer anderen Schule sich auf das Abitur vorbereiten, Natter eine Ausbildung zur Zahntechnikerin beginnen.
Die Grenze zur Tschechoslowakei wurde geschlossen; wenn Katharina vor dem Fernseher saß, überfiel sie wieder die schwer abzuwendende Angst, der Platz der Freundin würde am nächsten Morgen leer bleiben. Aus der Botschaft in Prag wurden schreckliche Bilder gesendet: verzweifelte, weinende Menschen. Kinder, die über hohe Zäune gezerrt wurden. Aus der Parallelklasse der Zehnten verschwand ein Mädchen, aus den beiden Neunten vier Schüler. Wer krank war und sich nicht sofort entschuldigte, galt als ausgereist.
Am letzten Freitag im September – Heinrich Grube versuchte, die Kenntnisse der Zehnten in der Elektrizitätslehre aufzufrischen -, wurde die Tür zum Klassenraum aufgerissen, ohne dass es vorher geklopft hatte.
Jemand sagte energisch: „Komm raus hier, Renate!“
Auf der Schwelle stand Natters Vater. Katharina hatte ihn noch nie so aufgeregt gesehen. Den Vater der Freundin kannte das Mädchen nur als ausgeglichenen Menschen, der fast noch jung wirkte.
Natter war, als ihr Vater in der Tür erschien, mit einem Ruck aufgestanden. Aber sie folgte seiner Aufforderung nicht, sondern blieb wie angewurzelt an ihrem Platz stehen.
In der Klasse herrschte absolute, angestrengte Stille.
„Wird’s bald!“, stieß Natters Vater aus.
Heinrich Grube, der wie die Klasse von Schockstarre befallen schien, fand seine Sprache wieder und sagte betont freundlich und gelassen: „Guten Tag, Herr Wagner. Sie können Ihre Tochter doch nicht einfach …“
Weiter kam er nicht, Natters Vater schrie ihn an: „Sie haben hier gar nichts zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann! Sie – Sie …“ Er suchte offenbar nach einem kräftigen Schimpfwort.“
Ebenfalls von Jutta Schlott stammt das 1989 im Kinderbuchverlag Berlin erschienene Buch „Farbenspiele. Das Leben des Malers Heinrich Vogeler“ – obwohl es kein Kinderbuch ist. Auf Wunsch der Autorin wurde das Buch nicht auf die neue Rechtschreibung umgestellt: Für Heinrich Vogeler, einen Bremer Kaufmannssohn, gehörte das Zeichnen und Malen seit seiner Kindheit selbstverständlich zum Alltag. Skizzen vom Leben auf der Straße, Studien von Tieren und arbeitenden Menschen füllen seine Zeichenblöcke. Aber erst nach langem Zögern gibt Vogelers Vater – der den Sohn lieber als seinen Nachfolger gesehen hätte – sein Einverständnis, dass Heinrich die Akademie besuchen darf, um später einmal Maler zu werden. Schon als sehr junger Mann gewinnt Heinrich Vogeler Medaillen und Auszeichnungen. Das Gestalten von Büchern und Gegenständen, die Ausstattung von Wohnräumen und Bauwerken bilden seinem Lebensinhalt. Er wird ein gesuchter Künstler und mit Aufträgen überhäuft. Sein Name, verbunden mit dem von ihm gewählten Wohnsitz, gilt als ein Markenzeichen: Vogeler – Worpswede. Das Signum ist gleichbedeutend für edlen Geschmack, Gediegenheit und Eleganz. Dem vom Erfolg verwöhnten jungen Mann wird in seiner Liebe zu dem Mädchen Martha, wie er hofft, Vollendung zuteil. Drei Kinder wachsen heran. Es ist das Glück und es soll dauern. Der Erste Weltkrieg, zu dem sich Vogeler als Freiwilliger meldet, wird zu einer tiefen Zäsur in seinem Leben. Seine Kunst steht nicht mehr im absoluten Mittelpunkt. Die Ehe mit Martha zerbricht. Der berühmte Künstler richtet auf seinem Wohnsitz, dem Worpsweder Barkenhoff, eine Kommune ein, er hilft den Kriegswaisen. Die Zeiten haben sich geändert, sie ändern auch den Heinrich Vogeler. Sein Lebensweg führt ihn von Worpswede nach Moskau, von Moskau nach Kasachstan …
Heinrich Vogeler leistete Bleibendes in Buchgestaltung und Design und gilt als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Jugendstils. Jutta Schlott, die Autorin dieser Biografie, vermag es, von Schönheit und Harmonie im Leben des Künstlers zu erzählen, wie auch von schwerer Selbsterfahrung und der Suche nach dem, was Heinrich Vogelers Leben Sinn geben sollte: „Das Wahre“. Hier des Beginn des 2. Kapitels:
„Am Abend des Totensonntages vor seinem sechzehnten Geburtstag saß Heinrich Vogeler in seinem Zimmer und versuchte, sich einen Text über die Obstbaumzucht einzuprägen.
Es war ganz still. Kein Fuhrwerk klapperte vorüber, keine Schritte knirschten. Kühler, nasser Herbst. Jeder Tag stahl sich aus dem Nebel und verdämmerte in ihm. Bald nach dem Mittagessen wurden die Lampen angezündet.
Das Okulieren, Pfropfen, Kopulieren. Die Lehrsätze sprach er leise vor sich hin: Bei den auf das treibende Auge okulierten Stämmchen nimmt man…
Ein gedämpfter Akkord klang an. Im großen Wohnzimmer spielte der Vater Klavier. Die Melodie des Lindenbaums… ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum…
Heinrich schob das Lehrbuch beiseite, stand auf, holte die große, mit Bändern verschlossene Mappe hinter seinem Schrank hervor. In ihr verwahrte er seine Zeichnungen.
Fünf Blätter wählte er aus: Eine Ansicht der Wallstraße. Annas Porträt. Eine blühende Ackerwinde. Die Kopie einer Federzeichnung, die Bismarck bei Donchery zeigt. Das Chamäleon.
Als er die Zeichnung des Tieres wieder betrachtete, entsann er sich, was ihn vor drei Jahren bewogen haben mochte, die Bilder zu verstecken.
Schläge oder entwürdigende Verhöre gab es für ihn und die Geschwister nicht. Keine Verbote, sondern Regeln der Vernunft. Wurden sie von den Kindern übertreten, prägten sich ein unmutiger Blick, des Vaters oder das Seufzen der Mutter nachhaltiger ein als lange Strafpredigten.
Trotzdem fühlte der Junge, daß außer den allgemeinen und offenen familiären Gesetzen auch andere, verborgene und unausgesprochene galten. Für das Muster einer Visitenkarte bedurfte es kaum mehr als eines guten Zirkels. Heinrich hatte sie im Zeichenunterricht angefertigt und erntete vom Vater wortreiches Lob. Als er ihm Tage später die Zeichnung einer Brennessel auf das Schreibpult legte, wurde Heinrich unwillig aufgefordert, er solle seine Rechenkünste verbessern, auch die Handschrift lasse zu wünschen übrig. Der Vater schien nicht zu bemerken, daß Heinrichs Arbeit einer Lehrbuchzeichnung in nichts nachstand. Alles war vollkommen so wie in der Natur: der aufrecht kantige Stiel, die grob gesägten, lang zugespitzten Blätter mit den Brennhaaren, die vielen kleinen, zu Rispen vereinten Blüten.
Papier ist teuer, schloß der Vater und reichte dem Sohn das Blatt zurück.
Laß die Kunst immer den Wein und nie das Brot des Lebens sein, hatte die Mutter gesagt, als er ihr ein Aquarell mit zwei Narzissenblüten schenkte.
Nur die jüngeren Geschwister bewunderten den Bruder uneingeschränkt. Sie ließen sich gerne helfen, wenn sie eine Initiale entwerfen oder mit Lineal und Winkelmesser eine Zierleiste konstruieren mußten.
Heinrich legte die fünf Blätter aus der Mappe nebeneinander: Ja, es waren die besten. Er würde sie dem Vater als Proben seines Könnens vorweisen.
Wie jedem Kind in der Familie wurde ihm zum Geburtstag ein Wunsch gewährt: Batterien bemalter Zinnsoldaten kamen so ins Haus, Puppenstuben, Kasperlepuppen, mechanische Eisenbahnen und der Brüder Grimms großes Märchenbuch. Für die Erfüllung der Wünsche sorgte die Mutter.
Heinrich wollte dem Vater sagen, was er zur Ermutigung leise für sich sprach: Laß mich Maler werden. Ich will. Ich muß.
Er mußte mit dem Bleistift der Neigung einer Blütenknospe nachspüren oder den Linien eines Gesichtes, die es unverwechselbar machten. Er mußte erfahren, warum mit dem Licht die Farben wechselten.
Was er gemalt und gezeichnet hatte, gehörte ihm, war für immer in seinem Gedächtnis gespeichert. Die Bilder, die dort lagerten, formten die Konturen seiner Träume. Die des Schlafens und die des Wachens. Der Vater hatte ein neues Lied angestimmt. Sein voller, sicherer Bariton übertönte das Klavier… manche Trän‘ aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee…
Entschlossen nahm Heinrich die Zeichnungen zusammen und legte sie zwischen weißes Papier. Lieber hätte er sie heimlich auf den Schreibtisch im Erker gelegt, aber er fürchtete, der Vater könne seine Arbeiten wortlos beiseite schieben.
Heinrich zog sich das Hemd zurecht, strich die Haare glatt. Über die große Wendeltreppe ging er nach unten.
Vor der Wohnzimmertür blieb er stehen, wartete, bis die letzten Töne verklungen waren… fühlst du meine Tränen glühen, da ist meiner Liebsten Haus…
Er klopfte.
Der Vater sah von den Noten auf, die Mutter von ihrem Journal. Ehe die Eltern etwas sagen konnten, fing Heinrich seine sorgfältig vorgedachte Rede an. Wochenlang hatte er sie abends vor dem Einschlafen immer wieder verbessert.“
2004 erschien im BS-Verlag, Rostock der Roman „Achterbahn. Höhenflug und freier Fall“ von Rudi Czerwenka: Sie heißen Karsten und Britta, Volker und Melanie und Günti und sind Menschen wie du und ich. Sie leben mitten unter uns, in den Nobelhotels und in den Obdachlosenasylen. Sie glänzen auf Promitreffen und Siegerpodesten oder verbergen sich in Abrissbauten und stillen Parkwinkeln. Sie tragen Kronen und Medaillen oder Plastebeutel und Lumpen. Sie sind ganz oben oder ganz unten oder auf dem Wege nach da oder nach dort auf der Achterbahn des Lebens. Karsten, Britta und Volker arbeiten in der Werft und sind im Großen und Ganzen mit ihrem Leben zufrieden. Sie beteiligen sich an den Demos zum Ende der DDR und fahren mit dem Trabi nach Lübeck, neugierig auf die Welt, in die sie vorher nicht reisen konnten. Karsten und Britta scheinen Gewinner der Wende zu sein und sind weit oben angekommen, Volker ganz unten. Doch ihr Leben ist wie eine Achterbahn …
Und so lernen wir zunächst einmal Karsten kennen, Karsten Bredlow. Und bald auch Britta, Britta, das Karbolmäuschen …
„Achterbahn
Der Regenschauer war vorbei, es nieselte nur noch leicht. Karsten Bredlow benutzte den betonierten Mittelstreifen der schmalen Straße zwischen dem Rohrlager der Werft und den Konstruktionsbüros. Eigentlich hatte er bereits Feierabend, doch zuvor musste er noch zur Zentralen FDJ-Leitung. Was die wollten, würde er bald erfahren. Sicher ging es wieder mal um die Vorbereitung einer der vielen Veranstaltungen. Da war Karstens Organisationstalent gefragt. Die Natur hatte ihn zwar mit einer nur geringen Körperhöhe ausgestattet. Doch wie viele andere etwas zu klein geratene Leute versuchte er, den äußerlichen Größenmangel durch andere Auffälligkeiten wettzumachen.
Seine Gedanken schweiften ab. Da war Jana, seine Derzeitfreundin, die auf dem Kabelkran arbeitete. Ihr Mundwerk war nicht totzukriegen, auch nicht nach längeren nächtlichen Strapazen. Sie hatte ihm erzählt, wie sich die Frauen auf der hohen Kranbrücke die Zeit vertrieben, wenn sie mal keine Schiffssektionen durch die Lüfte bewegten. Im Grunde ging ihn das nichts an, er saß schließlich in der Konstruktionsabteilung. Aber als Leitungsmitglied der Freien Deutschen Jugend fühlte er sich mitverantwortlich für die sozialistische Arbeitsmoral im Betrieb. Darüber hinaus hatte er einen weiteren Grund, sich gelegentlich ein bisschen hervorzutun.
Die Schuld lag bei seiner Mutter, bei Marta Sörgensen, geborene Schröder, verwitwete Bredlow. Sie zählte zu den Aktivistinnen der ersten Stunde, als das Prunkhotel des Seebades mit schwedischer Unterstützung konzipiert und errichtet worden war. Dabei hatte sie sich in einen der imperialistischen Aufbauhelfer verliebt, hatte ihn geheiratet und war nach mehrjähriger Wartezeit mit staatlicher Genehmigung ausgereist. Nun schickte sie Pakete, hatte ihren Sohn also beileibe nicht vergessen. Den Kaffee und andere hierzulande begehrte Luxusgüter übergab Karsten seiner Wirtin. Die Zigaretten verkaufte oder verschenkte er nur an zuverlässige Bekannte. Anderes Brauchbare wie den Bürokittel oder die Freizeitschuhe trug er selbst, weil er sicher war, dass seine Kontakte zu Personen im nichtsozialistischen, wenn auch befreundeten Ausland bekannt und registriert waren. Aus diesem Grund fühlte er sich verpflichtet, seine Treue zum Arbeiter- und Bauernstaat bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu demonstrieren. Diese Kranführerinnen aber auch! Das konnte man nicht durchgehen lassen. Er brauchte ja keine Namen zu nennen. Oder?
Die Ereignisse jedoch nahmen ihm eine Entscheidung ab. Von vorn näherte sich eine Dieselameise. Die relativ kleinen Räder des Transportfahrzeuges registrierten jede Unebenheit der Fahrbahn. Der Fahrer war es gewöhnt, er konnte sich am Lenkrad festhalten. Die Rohrladung hinter ihm jedoch schepperte und tanzte.
Karsten trat zur Seite, mitten in eine Pfütze, um den Karren vorbeizulassen. Auch der Kleintransporter scherte aus, vermutlich aber etwas zu plötzlich. Die Ladung kam ins Rutschen, ließ sich von den kurzen Seitenrungen nicht aufhalten, rollte und polterte auf die Betonpiste. Karsten sprang nochmals zur Seite, aber vergeblich. Die Rohre landeten vor, zwei sogar auf seinen Füßen.
Dem Fahrer war die Sache außerordentlich peinlich. Er weigerte sich strikt, als Karsten ihm beim Wiederaufladen der langen und auch recht schweren Transportgüter helfen wollte.
In der S-Bahn auf dem Heimweg betrachtete er seine guten Importschuhe. Sie waren ziemlich beschmutzt, aber heil geblieben. Der linke Fuß tat zwar ein bisschen weh, doch auch das würde sich geben. So hoffte er.
Am nächsten Morgen beim Aufstehen sah die Sache leider anders aus. Den Fuß konnte er kaum bewegen und zwängte ihn nur mühsam, unter Schmerzen ins Schuhwerk. Später vor seinem Reißbrett konnte er sich kaum auf den Beinen halten und holte sich den Rollschemel heran, den er sonst nie benutzte. Der Abteilungsleiter schickte ihn zum Betriebsarzt.
„Nur eine Prellung“, konstatierte der Mann im weißen Kittel nach der Röntgenaufnahme. „Drei Tage zu Hause bleiben, hochlagern und kühlen. Schwester Britta gibt Ihnen etwas mit. Und am Montag wieder vorstellen.“
So trat Britta in Karstens Leben. Zuerst hatte er sie in Erwartung einer vielleicht schlimmeren Diagnose glatt übersehen. Von diesen Ängsten befreit, betrachtete er sie nun genauer. Der weiße Kittel passte ausgezeichnet zu ihrem dunklen Teint, zu dem exakt geschnittenen schwarzen Pagenkopf. Ein bisschen ähnelte sie diesen zierlichen Gastarbeiterinnen aus dem befreundeten Vietnam.
Wie ein exotischer Vogel, wie ein bunter Schmetterling flatterte sie umher, sah ihn kaum an, als sie ihm mit spitzen Fingern sein Rezept und die Krankschreibung aushändigte.
Wie benommen verließ er die Praxis, schlich zu seiner Arbeitsstelle, fuhr nach Hause. Schwester Britta! Das war ein Mädchen, mit dem man sich überall sehen lassen konnte. Er grinste vor sich hin bei dem Gedanken, dass er sie irgendwann bei irgendwelchen geselligen Treffs anderen Leuten voller Stolz präsentieren könnte: „Darf ich bekannt machen – meine Freundin.“ Das war etwas anderes als Jana und die anderen emsigen Bienchen, die er manchmal mit nach Hause lotste und an den nächsten Tagen fast schon wieder vergessen hatte.
Er kühlte seinen Fuß, hatte weder Interesse am Lesen noch am Fernsehen noch an Radiomusik und dachte nur an sie.
Ungeduldig betrat er am Montag das zu dieser frühen Stunde noch leere Vorzimmer, suchte sich den optisch günstigsten Platz und wartete auf den Moment, dass sie ihn aufrufen würde. Doch er wurde enttäuscht; ein anderes Karbolmäuschen hatte heute Dienst.
„Noch Schmerzen?“, erkundigte sich der Arzt und betastete den leicht blaugrün gefärbten Fuß.
„Ziemlich, vor allem beim Auftreten.“ Karsten zuckte zusammen, um vielleicht einen weiteren Behandlungstermin zu ergattern.
„Sie brauchen ja nicht gleich wieder Fußball zu spielen. Was arbeiten Sie?“
„Technischer Zeichner. Konstruktionsbüro.“
„Na gut. Noch zwei Tage Schonzeit. Dann können Sie wieder antreten.“
„Bei Ihnen hier?“
„Nein, an Ihrem Arbeitsplatz.“
Niedergeschlagen verabschiedete er sich, hinkte betont langsam aus dem Untersuchungsraum, durchs Wartezimmer, die Treppe hinab. Am Ausgang jedoch besserte sich urplötzlich sein Befinden.
Denn vor ihm stand Britta, zwei prall gefüllte Einkaufsbeutel in den Händen. Er hielt ihr die Tür auf.
„Danke. Na, wie geht es dem großen Zeh?“
Sie hatte ihn also wiedererkannt. Das war ein gutes Zeichen und Anlass, sich innerlich wie auch äußerlich aufzurichten.“
Erstmals 1992 veröffentlichte Hans Bentzien im Verlag Volk & Welt Berlin seine Geschichte Brandenburg-Preußens für jedermann „Unterm roten und schwarzen Adler“: Unter dem roten Adler Brandenburgs und dem preußischen schwarzen wurde Geschichte gemacht: provinzielle, deutsche, europäische. Als Brandenburg wieder ein deutsches Bundesland geworden ist, muss seine tausendjährige Vergangenheit neu und dringend befragt werden. Hans Bentzien hat die Tatsachen möglichst selbst sprechen lassen: Überschaubar wird die aufsteigende Linie von der Markgrafenschaft über das Kurfürstentum und Königreich bis hin zum Kaiserreich und der Weimarer Republik. Die wichtigsten Gestalten Brandenburg-Preußens gewinnen Profil: der Große Kurfürst, Friedrich II., Gneisenau, Hardenberg oder Bismarck. Dennoch wird nirgends unterstellt, die preußische Geschichte sei die selbstherrliche Leistung einzelner überragender Menschen. Vielmehr erzählt Bentzien von zumeist dramatischen Konflikten: Jahrhundertelang musste sich das Herrscherhaus mit dem Adel und dem Bürgertum arrangieren. Oft floss Blut, manchmal wurden glänzende politische Vergleiche geschlossen. Fast immer hatten die Bauern die Zeche zu zahlen. Zwar fanden sie unter den Reformern der Napoleonischen Zeit, in den Freiherren Hardenberg und Stein zumal, leidenschaftliche und wirkungsvolle Anwälte, aber der Gegensatz zwischen Arm und Reich blieb, ja er verschärfte sich noch durch die Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert.
Als Land der europäischen Mitte, zudem ehrgeizig auf Erweiterung bedacht, musste Preußen immer wieder Kriege führen, fast schicksalhafte wie den Dreißigjährigen oder solche um Territorialgewinn wie unter Friedrich II. Schließlich wurde zweimal die Brandfackel über die Welt geschleudert: 1914 und 1939. Obwohl dieser Wahnsinn längst nicht mehr im Namen Preußens geschah, war nicht zuletzt sein Ende der Preis dafür. Zu Beginn seines Buches skizziert Hans Bentzien die Vorgeschichte Brandenburgs:
„Es kommt darauf an, wann man das Jahr Null Brandenburgs ansetzt.
Das Land zwischen Oder und Elbe, Ostsee und Erzgebirge, im Osten des Reiches gelegen und daher eher nebensächlich von der Herrschenden behandelt, war als Ergebnis der neu gestaltenden Völkerwanderung in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitrechnung ein Land mit gemischter Bevölkerung, dominiert von slawischen Stämmen, hauptsächlich von den Hevellern und Lutizen. Sie beschäftigten sich mit Jagd und Fischerei, gelegentlich auch mit dem Anbau von Feldfrüchten. An Zahl der Einwohner gering, als Land ausgesprochen dünn besiedelt, galt es als ein Durchgangsland voller natürlicher Hindernisse, Sümpfe und Seen, das leicht zu verteidigen war. Slawen und Germanen, bereits zu Völkerschaften entwickelt, lebten nebeneinander, zumeist friedfertig, aber durchaus nicht immer, denn das Land hatte keinen starken Herrscher, der feste Grenzen gezogen hätte. So galt das Recht des Ansässigen, das, wie aus der Geschichte aller Völker bekannt ist, am meisten umstrittene Recht.
Immer wieder wurden meist örtliche Auseinandersetzungen um das beste Land geführt, um den günstigsten Platz, den sichersten Weg. Allgemein war das Land kulturell wenig erschlossen, es wurde nur von einer bedeutenden Straße durchzogen. Sie reichte von Berlin nach Magdeburg, ging über den interessanten Platz auf der Mitte des Weges mit einer Furt über die Havel, über Brandenburg. Von Berlin aus begannen Straßen an die Odermündung (Stettin), nach Hinterpommern und Pomerellen, dem späteren Westpreußen, nach Posen und Warschau und schließlich nach Breslau. Allerdings verlief die wichtigste Ost-West-Straße von Schlesien aus über Leipzig und Dresden. Berlin wurde also der natürliche Mittelpunkt des Gebietes, was schließlich den Ausschlag für seine Rolle als Hauptstadt gab. Von ähnlicher Bedeutung zeigten sich die Wasserstraßen Oder und Elbe und ihre Querverbindungen Spree und Havel. Mit einem heutigen und daher nicht ganz zutreffenden Begriff könnte man das Gebiet der späteren Mark Brandenburg als natürlich gut erschließungsfähig bezeichnen.
Staatlich gesehen waren die Dinge unklar, wie bei allen Ostgrenzen des Reiches. Vor tausend Jahren musste der deutsche König Heinrich I. (919 – 936) das Reich neu ordnen und „strukturieren“. Mit ihm regierte die Sachsen-Dynastie, unterstützt von den Franken. Zuerst fügte er aus der Erbmasse des sich auflösenden Westfranken Lothringen an Deutschland, dann schloss er mit den im Osten vordringenden Ungarn einen Waffenstillstand, den er dazu nutzte, die Ostgrenze militärisch zu befestigen und eine neue Waffe, den Panzer der damaligen Zeit, das gepanzerte Reiterheer, aufzubauen.
Mit ihm errang er an der Unstrut einen Sieg über die erneut nach Sachsen und Thüringen vordringenden Ungarn. Beteiligt waren alle deutschen Stämme, wodurch das Königtum gestärkt und in die Lage versetzt wurde, die Angriffe aus dem Osten 955 abzuwehren, endgültig durch die Schlacht auf dem Lechfeld unter der Leitung Ottos I.“
Mit seiner Historie für jedermann spricht Hans Bentzien, der übrigens in jungen Jahren einst in Greifswald und Jena Geschichte studiert hatte, eine Einladung aus – die Einladung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Denn ohne Kenntnis der Vergangenheit auch kein Verständnis der Gegenwart und für die Zukunft, so heißt es. Und nur auf diese Weise – in Kenntnis dessen, wie es so gekommen ist, wie es gekommen ist – lassen sich teils schreckliche Fehler der Vergangenheit vermeiden. Nicht zuletzt darum ist das Studium der Geschichte so wichtig – für jedermann. Und das gilt für Brandenburg wie für alle anderen neuen und alten Bundesländer, für Deutschland, für Europa und natürlich für die gesamte Welt.
Das gilt auch für die vergleichsweise jüngere Geschichte, wie sich in den Biografien des Malers Heinrich Vogeler sowie von Katharina und Roland, von Karsten und Britta und den vielen anderen Menschen wiederfindet. Bleibt die Frage danach, wie Sie die Mauerfall und Wende und die Zeit danach erlebt haben? Und wie geht es Ihnen heute? Fragen über Fragen, auf die es ganz persönliche Antworten gibt und – wieder neue Fragen …
Viel Vergnügen beim Lesen und beim Nachdenken über alte und neue Zeiten, einen schönen Sprung in den letzten Monat dieses Jahres und eine besinnliche Adventszeit, bleiben Sie auch gegen Ende des Jahres weiter vorsichtig, vor allem aber weiter gesund und munter und bis demnächst.
Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Ansprechpartner:
Gisela Pekrul
Verlagsleiterin
+49 (3860) 505788
Dateianlagen:
Weiterführende Links
- Originalmeldung von EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
- Alle Meldungen von EDITION digital Pekrul & Sohn GbR